Gelungener Fantasy-Roman, der sprachlich punktet und selten in Klischee-Fallen tappt
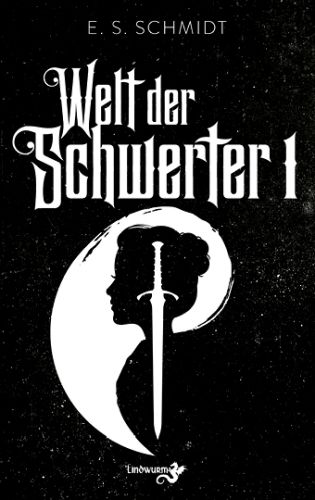
Ein Hoch auf die Sprache!
»Aus den Nüstern der Ulphane dampfte der Atem in den klaren Morgen, das Klappern ihrer Hufe hallte über den Schlosshof von Hohenvarkas. [S. 17]«
Diesen Satz habe ich stellvertretend für das gesamte Werk gewählt. Er zeigt, mit welchem sprachlichen Geschick E. S. Schmidt ihrer Welt Leben einhaucht. Als Leserin weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, was eine Ulphane ist, aber das spielt keine Rolle. Ich erfahre, dass dieses Tier Nüstern hat und Hufe trägt. Es erfüllt also vermutlich die Funktion eines Pferdes. Der Dampf am klaren Morgen verrät uns, dass wir uns in klimatisch kaltem oder maximal gemäßigtem Klima bewegen, und manche unserer physikalischen Gesetze auch in dieser Welt Gültigkeit behalten. Der Begriff „Schlosshof“ malt ein Bild, das uns im Gegensatz zu „Festung“ oder „Burg“ von archaischer Low Fantasy abgrenzt. Wir denken nun an Spätmittelalter, nicht an graue Felstürme, von denen aus Barbaren abgewehrt werden. All das liegt in einem Satz, der beiläufig an einem Szenenanfang fällt.
Eine glaubhafte Welt, gekonnt gezeichnet
Man verzeihe mir meine Begeisterung für Sprache und Erzählstil, aber sie ist berechtigt. Nicht nur einzelne Szenen oder eng begrenzte Ortschaften, sondern die ganze Welt, durch die unsere Heldinnen und Helden streifen, wird uns mit „Show, don’t tell!“ wie aus dem Lehrbuch vermittelt. Die eigentliche Story ist nicht allzu komplex, aber sie weiß, durch die Abfolge der Geschehnisse Spannung und Dramatik zu wecken. Ganz einfach auf den Punkt gebracht: Coridan, der semi-legitimierte Bastard des Herrschers, soll die „Hohepriesterin“ Lynn zu seinem Bruder Siluren, dem rechtmäßigen Thronfolger, eskortieren. Die Vermählung der beiden ist beschlossene Sache, weder Lynn noch Siluren hatten jemals eine Wahl. Eine Mischung aus Magie und Tradition sorgt für vollendete Tatsachen. Oder sollte dafür sorgen, denn der Krieg bricht übers Land herein – und wirbelt auch die geplanten Schicksale gehörig durcheinander.
Charaktere mit Überraschungspotential
Gut gelungen sind auch die Charaktere, ihre Zeichnung und ihre Entwicklung. Prinz Siluren, vom Vater als Schwächling betrachtet, erinnert an den „Keksprinz“ Lodrik Bardri¢ aus der „Ulldart“ Reihe. Nicht in Punkto Verweichlichung oder gar Körperfülle. Aber in der Art und Weise, wie er sich als gewiefter Taktiker entpuppt und jene überrascht, die ihn sträflich unterschätzen. Sein Halbbruder Cordian hingegen, der nach dem Klischee-Handbuch des Genres eigentlich ein neidischer, intriganter, sich heimlich nach dem Thron sehnender Antagonist sein müsste, bestreitet glaubwürdig eine Rolle, die so ziemlich das Gegenteil davon bildet. Auch er ist nicht frei von Widerspruch und Überraschungen, aber seine Interaktion mit Lynn zeigt deutlich, wie stark er an Prinzipien und der Treue seinem Halbbruder gegenüber festhält. Lynn selbst ist – nun, eine wohltuende Abwechslung vom Genre-Einerlei, sie hat ihren eigenen Kopf, ihre eigenen Vorstellungen, Wünsche und Begierden. Und die stimmen so gar nicht mit dem überein, was das Schicksal – oder die Göttin – für sie vorsehen. Sie wirkt modern, in positivem Sinne.
Auch Nebencharaktere wie Silurens Onkel Elim sind keine einfachen Platzhalter oder Funktionsprotagonisten, sondern komplexe menschliche Wesen. Und Kira – aber da wäre wohl jedes Wort ein Spoiler, also schweige ich lieber.
Der Kampf macht Laune
Zumindest der erste Band von „Welt der Schwerter“ ist kein kampflastiges Buch und schon gar keine Aneinanderreihung von Duell- und Schlachtszenen. Dennoch klirren die Schwerter, und sie tun dies überaus packend. Einen Kampf gut, glaubwürdig und mitreißend zu erzählen ist eine Kunst. Und diese, richtig gemacht, oft die Glasur auf einem leckeren Fantasy Kuchen. Dabei gibt es durchaus unterschiedliche Ansätze, wie dies gelingen kann: Tolkien, nicht gerade für actionlastiges Schreiben berühmt, vermittelte bahnbrechend vor allem die Dimensionen, die Epik einer Schlacht zwischen zehntausenden verfeindeten Truppen. Und die desaströse Wirkung von „Superwaffen“ (Nazgul, Olifanten) auf die einfachen Soldaten. Der „Tanz des Klingensängers“ überzeugte mich mit der „Zeitlupe“ einer kurz ins Präsens verschobenen Handlung, in der sich die Sekunden dehnen und die Wahrnehmung des Kämpfenden geschärft ist. Die „Witcher“ Romane brillieren vor allem bei den Zweikämpfen, wo der Einsatz übernatürlicher Fähigkeiten punktgenau gesetzt oft die Wende bringt und geschickt in den Erzählungsfluss eingebunden ist.
E. S. Schmidt hat vor allem bei der Taktik und Schlachtübersicht so manches As im Ärmel. Die Manöver sind ebenso glaubhaft wie klug und dramatisch beschrieben, ohne die Gesamtübersicht zu verlieren. Der Schlachtverlauf und -ausgang wird durch Intelligenz, Planung und die richtige Reaktion bestimmt. Die Danksagung an Sun Tzu im Nachwort des Buches kommt nicht von ungefähr. Das macht ebenso Laune wie die tatsächlichen Kampfhandlungen im Detail, die Autorin hat es einfach drauf.
Nicht ganz klischeebefreit, nicht ganz unproblematisch
Mein größter Kritikpunkt ist eigentlich ein historisch begründeter, und er bezieht sich auf Klischees. Denn ganz ohne kommt auch E. S. Schmidt nicht aus: Das Damsel in Distress Trope wird zwar von der geistigen Reife und der Selbstsicherheit entschärft, ist aber gegen Ende ihres Handlungsbogens in Band 1 durchaus präsent. Inklusive der Intention, sich einem Retter / Beschützer „hingeben“ und „schenken“ zu wollen. Was mich viel mehr stört: Die Vorstellung von der Kinderehe und dem Vollzug derselben hält sich hartnäckig in der Fantasyliteratur, die vorgibt, sich am europäischen Mittelalter zu orientieren. Was dabei übersehen wird, ist die Tatsache, dass es sich bei diesen Eheversprechungen um genau dies handelte – Versprechen, die erst viele Jahre später eingelöst wurden. Das tatsächliche Heiratsalter lag bei Männern der Oberschicht zwischen 20 und 30 Jahren, bei Frauen zwischen 17 und 22. [1][2]
Warum ich ausgerechnet bei einem Fantasyroman auf historischen Tatsachen herumreite? Ganz einfach: Diese Fehlinterpretation beschert uns seit der Anfangszeit des Genres bedenkliche Beschreibungen, Andeutungen und Suggestionen von erwachsenen, manchmal drei- bis vier Mal so alten Männern, die sich legal, ja sogar von der Gesellschaft gefordert, über dreizehn bis fünfzehnjährige Mädchen „hermachen“, „sie besteigen“ oder „über sie herfallen“. Dieses Muster, dessen Ursprung eher in misogynen Fantasien mancher Fantasyautoren als in historischen Vorbildern zu suchen ist, spiegelt sich leider hier zumindest anfangs wider. Auch wenn die Autorin sich dem innerhalb der Grenzen des Werkes entgegenstellt: Dass Siluren uns als besonders einfühlsam und sensibel verkauft wird, weil er nicht mit einer (zu diesem Zeitpunkt gemutmaßten) Dreizehn- oder Vierzehnjährigen gegen ihren Willen „das Lager teilen“ will, hat trotz der hehren Intention einen unangenehmen Beigeschmack.
Fazit
„Welt der Schwerter“ ist ein über weite Strecken rundum gelungener Fantasyroman, dem man jeder und jedem auch nur irgendwie am Genre Interessierten vorbehaltslos empfehlen kann. Gelegentlich stürzt sich vielleicht nicht die Welt, aber die Erzählung in das eigene Schwert bekannter Fantasy-Muster. Aber die meisten Stereotype und Klischees werden geschickt vermieden oder sogar gezielt gekontert. Wir bekommen eine bemerkenswert komplex ausgearbeitete, in sich schlüssige Welt, die ebenso wie ihre vielseitigen und teilweise überraschend konzipierten Protagonistinnen und Protagonisten hervorragend aufgebaut wird. Gelungene Kampf- und Konfliktszenen runden das Spektakel ab, und ich freue mich auf Band 2.
Tamara Yùshān
[1] Philips, Kim M. 2003. Medieval Maidens: Young Women and Gender in England, C.1270-c.1540. Manchester University Press. Pg 37
[2] Seccombe, Wally (1992). A Millennium of Family Change, Feudalism to Capitalism in Northwestern Europe. Verso. pp. 184–186. ISBN 0-86091-332-5.
Welt der Schwerter, Band 1 einer Dilogie
Fantasy
Lindwurm Verlag
Oktober 2021
eBook
343
Markus Weber
85
